Rezension von They Call Us Animals, Regie: Catrin Hedström, Schweden/USA 2011
Das Unsichtbare sichtbar zu machen gilt als eine der grundlegendsten Fähigkeiten des Mediums Film[1]. Dies gilt sowohl für das Vorzeigen von unbemerkten Details und Zufälligkeiten, als auch für Neuordnungen und Umformungen gewohnter Zusammenhänge.
Der experimentelle Kurzfilm They Call Us Animals der Regisseurin Catrin Hedström spielt mit diesen beiden Aspekten des (Un-)Sichtbaren.
Hedström präsentiert uns nackte Menschen, genauer Details nackter Körper: Haut, die sich über Muskeln spannt; Münder, die sich verziehen; Augen, die sich verdrehen. Ausschnitte, die in einer Nähe und Perspektive aufgenommen wurden, die uns ungewöhnlich, ja fremd erscheint. Hedström scheint uns menschliche Körper in ihrer animalischen Körperlichkeit zeigen zu wollen. Muskeln werden angespannt, Zähne gefletscht, die Haare werden zu Fell, Hände zu krallen, gegen Ende fließt sogar etwas Blut.
Andererseits befinden sich die Körper in einem steten Fluss, das Bild in steter Wandlung. Zu treibender Hintergrundmusik wird in schneller Schnittfolge eine Detailaufnahme an die nächste, ein Körper an den nächsten, Auge an Nase an Mund an Arm an Hand an Schulter geschnitten. Die Kontinuierlichkeit eines Einzelkörpers weicht der Kontinuierlichkeit des Massenkörpers.
Die gezeigten Körper sind männlich, weiblich, schwarz, weiß; kurzum bunt in scheinbar jedweder menschlichen Schattierung. Es scheint fast als würden die Grenzen zwischen diesen Körpern verschwimmen, die Grenzen zwischen Hautfarben, zwischen Geschlechtern. Der Mensch also reduziert auf seine Körperlichkeit. Hierin scheint der Film dann auch das basalste, egalitärste Element des Menschen finden zu wollen: in seiner Tierhaftigkeit, vielleicht auch seiner Triebhaftigkeit. Der Film scheint geradezu zu schreien: Wir sind doch alle nur Tiere!
Leider scheitert seine Forderung auf halber Strecke. So sehr die Regisseurin sich auch zu bemühen scheint diese aufzulösen, reproduziert sie doch wieder viele gesellschaftliche Normen und Trennlinien. Warum sind es vorwiegend männliche Körper die ihre Muskeln spielen lassen und weibliche die ihre Rundungen präsentieren? Warum werden gerade die Frauen mit Milch überschüttet, lecken sie auf, werden von Männern gewürgt? Warum nehmen gerade wieder schwarze Körper besonders animalische sowie besonders unterwürfige Posen ein? Warum sehen wir nur athletische Körper, attraktive Körper in all ihrer makellosen Ästhetik? Wo sind die Fetten, die Hässlichen oder wenigstens die Untrainierten?
In seinem Sog aus Bildern, unterstützt von der treibenden Rhythmik der Musik, die in der ebenso treibenden Rhythmik des Schnitts ihren Widerpart findet, lässt der Film diese Fragen gar nicht erst aufkommen. Seine kaleidoskopischen Bildflächen fangen uns ein und der Beat treibt uns weiter. Gefangen in diesem konstanten Fluss der medialen Reizüberflutung, bietet sich für uns kein Ort der Reflexion. Die Unterbrechung, die Pause[2] ist nicht Teil dieser filmischen Formensprache, deren oberstes Gebot die ästhetische Einheit zu sein scheint.
Zumindest in dieser Hinsicht ist der Film auch gelungen, wirkt er doch wie aus einem Guss. Doch diesem Guss hätte der eine oder andere Bruch wohl nicht geschadet.
Endnoten
[1] So sprach etwa Walter Benjamin in seinem Kunstwerkaufsatz vom „Optisch-Unbewussten“ von dem wir erst durch die Kamera erfahren.
[2] Unterbrechung und Pause haben schon Walter Benjamin und Alexander Kluge als zentrales Element der Reflexions- und Kritikfähigkeit, gerade im Film, herausgearbeitet.



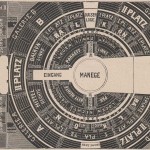

Kommentare von Bernhard Frena